Waldbaden – für den Trend aus Japan braucht man weder Handtuch noch Bikini. Unsere Reporterin hat den Selbstversuch gewagt und ist mit allen Sinnen tauchen gegangen.
Von Sophia Junginger

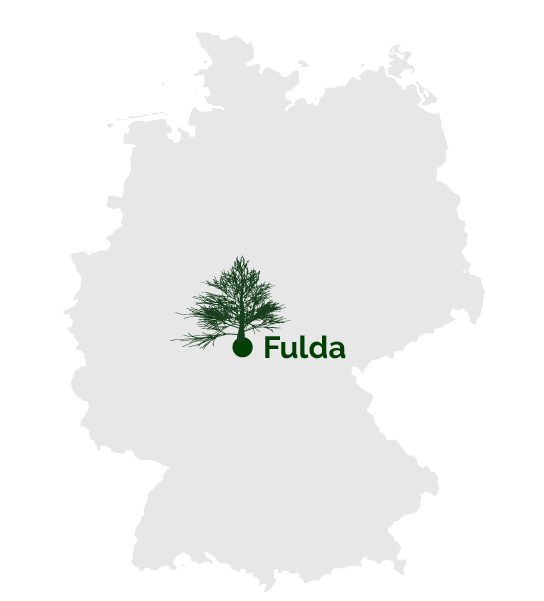
Wann haben Sie das letzte Mal im Wald gelegen? So richtig auf dem Boden, der Länge nach ausgestreckt, die Augen geschlossen? Ich tippe mal – Sie können sich nicht dran erinnern. Keine Panik: Mir ging es genauso. Und dann habe ich mich in den Wald gelegt.
Und zwar so richtig: Auf dem kalten Waldboden, zwischen feuchtem Laub und harten Ästen, die Augen geschlossen, den Kopf angelehnt an eine schätzungsweise 20 Meter hohe Buche. Die Sonne schimmert durch die dicht gewachsenen Baumkronen, mein Kopf ruht auf angenehm weichem Moos, das die Buche hinaufwächst. Ich atme tief ein und aus, mein Herz schlägt ruhig, ich höre verschiedene Vögel zwitschern, Blätter rauschen, Hölzer knacken. Hach, is dat schee. Eine sanfte Stimme reißt mich aus meinen Gedanken: „Du kannst deine Augen jetzt wieder öffnen“, flüstert sie. Ich mache die Augen auf, blinzle ein paar Mal gegen die Sonne und schaue Stephanie Mahr an. Eigentlich will sie lieber Stephi genannt werden.
„Und, konntest du dich entspannen?“, fragt sie und schiebt ihre rote Lesebrille wieder zurück auf ihr blondes Haar. Sie hat mir eine Traumreisegeschichte vorgelesen, der ich bis zu einem gewissen Punkt folgen konnte. Irgendwann habe ich aber nur noch dem Wald gelauscht. Ja, ich habe mich entspannt. Es ist schön, die kalte Buche im Nacken zu spüren, ich wusste gar nicht, dass Bäume solch eine kühlende Wirkung haben können. „Deswegen im Sommer einfach mal in den Wald gehen und an einen Baum anlehnen – das wirkt Wunder“, verrät mir Stephi. Sie muss es ja wissen. Als zertifizierte Waldbademeisterin. Und Waldbaden, also das, was wir zwei hier machen, wird auch nachgesagt, dass es in gewisser Weise Wunder bewirken kann.
Die Tradition des Waldbadens kommt ursprünglich aus Japan. Dort bezeichnet man es als „Shinrin-yoku“ und versteht darunter das Eintauchen in den Wald mit all unseren Sinnen. Das intensive Spazieren durch den Wald hat in Japan eine lange Tradition und wird auch zur Therapie verschiedener Erkrankungen genutzt. Beispielsweise Burnout und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden mit Waldtherapie behandelt. An japanischen Universitäten ist Waldmedizin sogar ein anerkanntes Forschungsgebiet. „In Deutschland ist das leider noch nicht der Fall“, sagt Stephi. Zwar gibt es auch hier Forschung zum Thema Waldtherapie, beispielsweise an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und es entstehen immer mehr Natur- und Heilbäder, so wie auf Rügen oder im Schwarzwald. Den Wald als Medizin auf Rezept gibt es allerdings noch nicht.
Plötzlich sehe ich eine kleine Zecke über meinen linken Handrücken krabbeln. Ich schnipse sie hektisch mit dem rechten Zeigefinger weg und stehe auf. Klopfe meine Klamotten ab und schüttle meine Haare kopfüber aus. Keine Lust, hier am Ende mit mehreren Zeckenbissen rauszugehen. Stephi sieht das entspannt. Sie trägt, im Gegensatz zur mir, eine Jeans mit kurzem Bein. „Ach, ich bin da schmerzfrei. Außerdem reibe ich mich immer mit Kokosöl ein. Das können die kleinen Dinger gar nicht leiden“, sagt sie. Wir beschließen, weiterzugehen.
Wir sind unterwegs in einem Waldstück nahe Fulda. Aber nicht auf einem ersichtlichen Wanderweg, sondern wirklich richtig im Wald. Also so mittendrin. Laufen durch hohes Gras, müssen unter entwurzelten Baumstämmen durchkrabbeln und im wahrsten Sinne des Wortes tierisch aufpassen, wohin wir treten. Denn Wildschweine haben den Waldboden umgegraben. „Wenn du so genau auf den Boden schaust, dann guck‘ immer mal rechts und links, was du so findest“, weist mich Stephi an. Das gehört nämlich zum Waldbaden dazu: sich Zeit nehmen, den Wald neu zu entdecken.
Also schlendern wir schweigend durch den Wald, bewusst sehr langsam. Es lohnt sich. Ich entdecke einen großen schwarzen Mistkäfer, der sich totstellt, als ich mich zu ihm bücke. Ganze Kolonien von saftig grünen Kleeblättern, eine Weinbergschnecke, die einen großen Grashalm hinaufkriecht. Und viele Bäume und Pflanzen, deren Namen ich nicht kenne. Es ist mir fast peinlich, dass ich so wenig über unseren Wald weiß. Immerhin ist Deutschland zu einem Drittel mit Wald bedeckt und damit eins der waldreichsten Länder Europas.
„Jetzt machen wir mal eine andere Übung, in der geht es um Vertrauen“, unterbricht Stephi unser Schlendern. Ich muss eine schwarze Schlafmaske anziehen und meine Hände öffnen. Ganz ehrlich: Ein bisschen komisch komme ich mir dabei anfangs schon vor. Aber auch das ist unumgänglich beim Waldbaden. Man muss sich drauf einlassen. Also stehe ich da, mitten im Wald, und warte darauf, dass mir Stephi etwas in die Hand legt. Ich muss ihr vertrauen, dass es nichts Ekliges oder Gefährliches ist. Dann spüre ich etwas Weiches in meinen Händen. Ich soll Stephi beschreiben, wie es sich anfühlt. Sanft, aber trotzdem ein bisschen rau, nicht flauschig. An der Unterseite etwas feucht. Die kurzen Härchen, die aus der Oberfläche ragen, fühlen sich stumpf an. Was das wohl ist?
Ich darf meine Augen öffnen und sehe das, was ich getippt habe: Moos. Die Übung hat mich den Wald anders wahrnehmen lassen als sonst. Ich habe ihn nicht gesehen, sondern gespürt. Stephi fragt mich, wann ich das das letzte Mal getan hätte? Den Wald gespürt. Vermutlich als Kind. Auch eine Sache, die das Waldbaden ausmache, erklärt Stephi. Sie selbst ist Mitte 50 und findet: „Im Wald dürfen alle mal wieder Kind sein! Bäume anfassen, Waldluft einatmen und vor allem unbeschwert sein. Den Stress des Alltags und alle Probleme für eine gewisse Zeit beiseite schieben.“
Dabei habe ihr der Wald zumindest geholfen. Denn sie selbst litt unter Burnout. Sie war 30 Jahre lang in einem Unternehmen, wie sie selbst sagt, das Mädchen für alles. Irgendwann konnte sie nicht mehr. „Und dann habe ich gemerkt, dass mir der Wald unglaublich guttut. Ich habe meinen Job gekündigt und mich zur Waldbademeisterin ausbilden lassen. Im Nachhinein kann ich sagen, der Wald hat mich geheilt.“
Dass der Wald heilende Kräfte hat, ist tatsächlich kein Hokuspokus. Eine der ersten Studien zum Thema veröffentlichte der Gesundheitswissenschaftler Roger S. Ulrich im Jahr 1984. Er stellte fest, dass Patienten, die sich einer Gallenblasenentfernung unterzogen und ein Krankenzimmer mit Waldblick hatten, sich schneller und unkomplizierter von der Operation erholten, als jene Patienten, die nicht auf Bäume blicken konnten. Auch der Umweltpsychologe Marc Berman von der University of Chicago machte 2015 eine spannende Entdeckung: Er glich die Gesundheitsdaten der Bewohner Torontos mit der Baumdichte innerhalb der Stadt ab. Mit dem Ergebnis: Je mehr Bäume in einer Wohngegend stehen, desto niedriger ist das Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.
Als Pionier der Waldmedizin gilt allerdings ein anderer. Professor Qing Li von der Nippon Medical School in Tokio ist es zusammen mit anderen Forschern gelungen, zu erklären, woher der positive Effekt des Waldes auf das menschliche Immunsystem kommt. Er ließ Probanden an zwei Tagen mehrere Stunden durch den Wald laufen. Er untersuchte ihr Blut vor und nach dem Waldbaden und erkannte, dass sich die Anzahl ihrer körpereigenen Killerzellen nach dem Waldbaden um 50 Prozent erhöht hatte. Killerzellen sind Zellen unseres Immunsystems, die kranke oder infizierte Körperzellen erkennen und zerstören.
Stephanie Mahr sagt, sie fühle sich einfach zu Hause im Wald. Hier sei die Welt noch in Ordnung. Und auch ich muss sagen, je länger ich im Wald bade, desto entspannter werde ich. Desto weniger nehme ich wahr, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem wir in den Wald gegangen sind. Und desto weniger Hemmungen habe ich, auch mal einen Baum anzufassen, wenn ich an ihm vorbeilaufe. Nein, ich umarme ihn nicht. Obwohl das durchaus zum Waldbaden dazugehöre, meint Stephi.
Wir sind mittlerweile über zwei Stunden im Wald unterwegs. Immer wieder staune ich, wie groß manche Bäume sind. Dann bleibe ich stehen, schaue hoch in die Baumkronen und fühle mich ganz klein und auch ein bisschen ehrfürchtig. Meine Sorgen und alles, was mich stresst, werden unwichtig. Hier im Wald habe ich das Gefühl, ganz für mich sein zu können. Ohne jemandem Rechenschaft dafür abzulegen. Und ich frage mich: Wann bin ich das letzte Mal bewusst in die Natur gegangen, um durchzuatmen? Nicht um zu wandern, Fahrrad zu fahren oder das nächste schöne Foto für Instagram zu machen. Sondern nur, um Zeit für mich zu haben? Ich weiß es nicht.
„So, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter gehen, dann kommen wir an den Waldrand und da steht ein richtig dicker, alter Baum. Da gehe ich immer zum Schluss hin mit meinen Leuten“, sagt Stephi. Ihre Leute, mit denen sie waldbaden geht, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Die gestresst sind, Ängste haben, unter Druck stehen.
Am dicken Baum angekommen, hören wir mehrere Familien mit kleinen Kindern ein paar Meter von uns entfernt. Ihre Hunde bellen sich an. Es ist plötzlich wieder laut. Und es stört mich.
Fast drei Stunden war es still um mich. Alles was ich gehört habe, war der Wald. Jetzt höre ich andere, schrille Stimmen. Sehe Müll auf dem Boden liegen: Toilettenpapier, ein kaputter Einweg-Grill, ein benutztes Kondom. Es stört mich wirklich. „Kann man nicht einmal seine Ruhe haben?“, denke ich mir. Verrückt, wie schnell ich mich an die Stille des Waldes gewöhnt habe. Und mit einem Mal wird mir klar, dass wir zurück sind. Zurück unter Menschen. Ich kann mich gar nicht richtig auf den dicken, alten Baum konzentrieren. Viel zu abgelenkt bin ich von den bellenden Hunden.
Stephi und ich gehen zurück zu unseren Autos, die wir nahe am Waldrand geparkt haben. Auf ihrem Smart steht dick und fett: Shinrin-yoku – Waldbaden. Ein altes Ehepaar läuft an uns vorbei, liest den Schriftzug und fragt: „Shinrin-yoku, was ist das denn bitte?“ Stephi erklärt es ihnen und die beiden grinsen sich an. Der Mann sagt: „Ach, das ist aber eine schöne Sache. Ich sag ja immer: Der Doktor Wald braucht keine Sprechzeiten, der hat nämlich immer einen Termin frei.“ Dass der Wald eine positive Auswirkung auf uns Menschen haben kann, lässt sich nicht abstreiten. Ich habe es selbst gemerkt: Das Waldbaden hat mich entspannt, mein Kopf wurde frei. Aber auch der Wald kommt mit seinen Heilkräften irgendwann an seine Grenzen. Er kann beispielsweise keine Gallenblase entfernen oder Krebszellen behandeln. Dafür braucht es dann die Schulmedizin.
Was ich dennoch mitnehme aus drei Stunden Waldbaden? Es braucht keinen Grund, keine Krankheit, kein gestörtes Wohlbefinden, um mal wieder den Weg in die Natur zu finden. Und: Ich sollte mich viel öfter in den Wald legen. Und zwar so richtig auf den Boden, der Länge nach ausgestreckt, die Augen geschlossen.


